
Ab jetzt fange ich einfach immer wieder von vorne an.
I’m on call
to be there
(Kings of Leon – On Call)

Ab jetzt fange ich einfach immer wieder von vorne an.
I’m on call
to be there
(Kings of Leon – On Call)





Wie du gehst und stehst und Stimmungen ausstrahlst, erinnert mich in aller Tiefe, Grausamkeit und Unausweichlichkeit an V; dann die großen Hände und der gleiche Weichspüler, gleiche Orte und eine ähnliche Fahrigkeit. Das ist nicht in Ordnung (und wird es auch nicht mehr).
Herr C thematisiert meinen Kopfschmerz, den, den ich Migräne nenne. Wirbel, die ganze Zeit, immerfort, in meinem Kopf, pochend in den Schläfen, manchmal gar keine Möglichkeit, Licht zu sehen, alles viel zu laut. Ich weiß nicht, was ich fühle, da fehlt der Zugang. In englischen Tageszeitungen schreiben sie über Tee und dessen Umsatzverlust, gerechnet auf fünf Jahre. Mir fehlt der stinkende, braune Fluß und die Brücken über ihn.
Dann fühle ich mich wie Niko aus Oh Boy, dann wie Richard, ich verstehe auch nicht mehr, was die anderen sagen. Grundrauschen, ähnlich wie die Hitze im Moment (meine Stimmung ist ähnlich stabil wie der Sommer in diesem Jahr). Filme, die dabei helfen, sich daran zu erinnern, wieso man in die Stadt kam und was man an ihr so hässlich findet und was schön (ja, die leeren Straßen in der Mitte der Nacht gehören dazu).


wir sitzen im Gang so halb im Licht
ich fühle mich wie du
Pluto, Zwergplanet, nichts komplettes
an der Birkenstraße haben sie die
Fliesen von der Wand geschlagen
die Tiere werden unruhig
denn die Züge fahren im Takt
und das Schöne dabei:
mir gehen dann durchaus die Worte aus
but gravity always wins
(Radiohead – Fake Plastic Trees)

27 6 15
Ich lerne, dass die Spree ein Knie hat und frage mich, wo ihr Fuß ist, wo ihr Kopf. Das Lachen darüber, dass ihre großen Ecken und Kanten nichts weiter sind als Randnotizen. Wir gehen alle in ihr auf, da hinten, in Erkner oder auf der anderen Seite von Brandenburg.
In der vierten Etage erzähle ich ihm davon, dass ich seit Oktober letzten Jahres nicht wollte, dass man mich irgendwo sehen kann. Nirgendwo in einer Dokumentation findet, nicht mal in meiner eigenen. Nicht wollen, dass man sehen kann, was ist. Er fragt mich, ob ich ahne, woran das liegt; dabei lösche ich gelegentlich, ausgiebig, intensiv mein Gesicht von unwirklichen Orten und so wie ich nicht will, dass ich andere störe, will ich keine Spur hinterlassen. Keine Daten, keine Erinnerung, nichts von mir war jemals wahr.
Ein halbes Jahr verschwinden, wenn nicht sogar länger: selbst das hört irgendwann einmal auf. Eigentlich habe ich mich vor nichts zu verbergen (auch nicht von mir), ich mag es roh und pur und treffend.
(Das habe ich lange nicht mehr getan, das Sich-Selbst-Portraitieren und es fühlte sich bis zu einem Grad sehr falsch an und auch auf der anderen Seite wiederum sehr richtig, weil ich immer noch weiß was ich tue und meine Haut so gerne in der Farbe meiner Wände verschwindet, vielleicht spricht sie dann für mich und den Kopf und das Stück schwarzes Loch in meinem Kopf, aber ich hätte das manchmal schon gern, dass man all das so nimmt, wie es ist und dass man trotzdem meine Hand nehmen mag dabei und sie loslässt, wenn ich das brauche und ich das zulasse.)
2 7 15
Du sagst, du hast Angst vor der Angst und du listest in feinsten Einzelheiten auf, was nicht funktioniert. Obsessiv bearbeitest du die Leerstellen in Interpretationsspielräumen. Hat man dir nicht beigebracht, dass es in den Menschen keine Belegtextstellen gibt? Stattdessen liest du von Leuten, die in Legenden wohnen und denen du dich anvertrauen möchtest, bevor dir die Argumente gegen – etwas, dich, andere – ausgehen.
(Oh, ich musste stehen bleiben und schreiben und dann im Abendwind sitzen und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass es mir gefehlt hat, dieses Atmen und Leben und dass ich es mag, wenn es zwiebelt und mich an London erinnert und ich manchmal vor mich hinseufze, wenn mich etwas erinnert an Waterloo Bridge und die Themse darunter und an die schlaflosen Nächte und die Zeit, die ich auf Dächern verbrachte.)
3 7 15
Du wachst auf in Betten, die deine sind und doch wieder nicht und du stellst die Ohren auf und horchst. Lässt dir den Kopf richten und aufsetzen und gehst dann in einem anderen Zustand wieder unters Volk, so, als hättest du deinen Aggregatzustand geändert oder deine Form. Dann hörst du den Leuten zu beim Reden und sammelst ein paar Gesprächsfetzen, als wären sie Ballons und als würde dich das Aufnehmen der Gedanken so hoch sprechen lassen wie Helium.
(Er sagte mir, ich soll mehr Signale lesen, ich soll mehr erlauben zu verstehen und loszulassen und die Kontrolle abzugeben und die Mauer abzubauen und vielleicht meinte er dann auch, dass ich mehr leben soll und dann wusste ich oft nicht, wieso die Dinge eigentlich so einfach sind, wenn man sie mir aus meiner Perspektive und mit meinen Narben und Mustern erklärt und ich mich manchmal mit manchen Menschen sehr sicher fühle und ich das nie sagen kann und vielleicht geht es ja auch darum, das mal loszulassen und zu sagen: du, ich mag dich, ich fühle mich sicher, ich habe keine Angst. Keine Mauern mehr, vielleicht, vielleicht lerne ich das gerade erst.)
do me a favour
open the door
and let them in
(Wings – Let ‚em in)
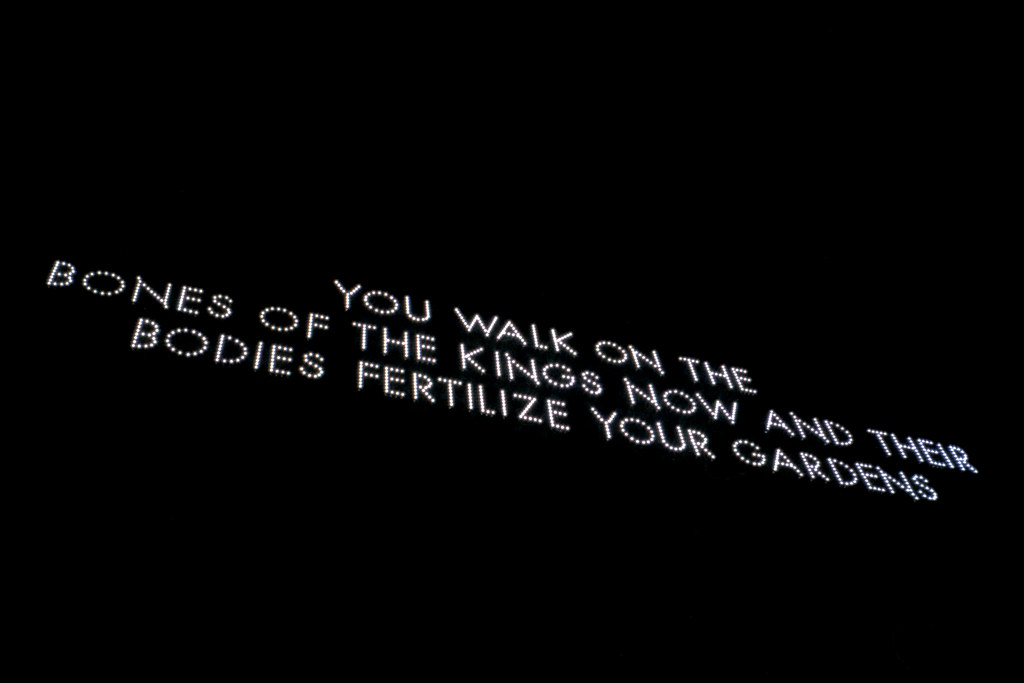

Das Lithium macht lethargisch. Ich entschuldige mich bei allen, denen ich auf die Nerven gefallen sein könnte. Bei allen außer mir, denn ich fühle mich nicht mehr. All die Eierschalen, die noch von meiner Sozialisierung an mir kleben, werde ich nicht los. Ich bin kein Charakter aus Hesses Demian, auch wenn ich mich daran erinnere, wie es war, in Calw auf seiner Grundschulbank zu sitzen. Auch wenn ich aus diesem Buch zitieren kann. Genauso wie aus „Der fremde Freund“ von Christoph Hein. Wer hätte gedacht, dass diese beiden Bücher, schon immer Schlüsselbücher für mich, mal so wahr werden würden. Nicht nur was den Titel anbelangt.
Träumst du nicht auch gelegentlich von Katharsis? Ich jedenfalls muss mir Gründe geben, nicht auf gewisse Erlebnisse zurückzufallen. Dafür die Tabletten. Ich hoffe du verstehst. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass man darüber zumindest mal nachdenken kann.
Das Valproat ist toxisch. Stimmungsstabilisatoren scheinen für meinen Körper auszufallen. Mitte Dezember Nierenkolik, dann fast Nierenversagen. Fast vier Tage am Stück verloren. Und die Stimme in meinem Kopf, die mir immer wieder sagt: ich will nicht in die Klinik zurück. Und die andere Stimme in meinem Kopf, die mir sagt: du solltest in die Klinik zurück.
Es gibt für Menschen keine Bedienungsanleitung. Nur die Aufkleber, die auch an Haltestellen kleben: Bitte hier streicheln. Alles weitere muss die Empathie regeln. Oder das pure Hineinversetzen in andere Menschen. Oder eben Altruismus. Ich möchte mich nicht mehr erklären müssen, nur um dann zu erfahren, dass man mir nicht zugehört hat. Ich möchte mich nicht mehr auf Arbeit übergeben müssen. Ich möchte mich generell nicht mehr übergeben müssen. Weder wegen Medikamenten noch wegen anderer Menschen noch wegen verstörender Erlebnisse. Ich möchte nicht mehr erleben müssen, dass nicht mehr zu leben die einzige Alternative zum derzeitigen Zustand ist.
Das Gefühl, eine Art von Schuld auf sich geladen zu haben, die man nie auf sich laden wollte. Ich bin das Gift, das man aus seinem Körper spülen muss. Das sagt mir mein Kopf.
Mein Kopf kann ein ziemliches Arschloch sein, wenn der Serotoningehalt nicht stimmt. Ich weiß, wovon ich rede (siehe oben).
Dann lebt man in Namen, die man sich selbst nicht gegeben hat. Oder lebt weiterhin in Namen, die man mal gekannt hat.
Doch vielleicht ist das nur der alte Mensch in mir drin. Der hat noch nie im aktuellen Zeitgeschehen gelebt. Er hat sich nämlich immer gewundert, wieso die Zeit so schnell vergeht.
Man stellt fest für 2015:
– Es ist nicht schlimm zu sagen, dass man in der Klinik war. Vor allem nicht, wenn es dabei hilft, einen Therapieplatz zu bekommen.
– Leben ohne Filter mag schmerzhaft sein, aber ein Leben mit Filter ist emotional verkrüppelnd.
– Ich bin nicht meine Vergangenheit, aber ich muss akzeptieren, dass sie momentan ein großer Teil meiner Gegenwart ist.
– Auch wenn ich panische Angst davor habe: ich verbrenne lieber für Menschen, als alles und jeden ewig auf Abstand zu halten.
– Selbstschutz ist legitim, kann aber unfassbar verletzend sein. In alle Richtungen.
– Ich sehe es nicht mehr ein zu schweigen. Ich sehe es nicht mehr ein, mich auf meine schlechten Momente, meine panischen, meine menschlichen Momente reduzieren zu lassen. Ich sehe es nicht mehr ein, mich ungerecht behandeln zu lassen. Ich sehe es nicht mehr ein, mir eine negative Intention für mein Handeln unterstellen zu lassen. Ich sehe es nicht mehr ein, das gesellschaftliche Stigma, das psychisch Erkrankte indoktriniert bekommen, zu tragen wie ein Kreuz.
– Ich kann nichts dafür, wenn man nicht mit mir spricht.
– Ich bin nicht schuld an meiner Erkrankung.
Am Dienstag habe ich mein erstes Therapievorgespräch.


Ich dachte immer, dass die kleinen roten Stellen, die man auf und zwischen den Knien findet, nur vom Gewicht des eigenen Körpers erzählen. Nichts von diesem Gedanken ist auch nur im Ansatz ein Teil der Wahrheit.
Je mehr man beobachtet, je mehr man versteht, je mehr man in Worte umsetzt, desto mehr wird man dafür bestraft. Als wäre es eine leichte Sache, anderen beim Leben zuzusehen und dann zu bemerken, dass man selbst nicht an deren Leben teilnehmen kann oder darf. Weil man vergessen hat, von sich selbst zu erzählen oder weil man schon so viel erzählt hat, auf Nachfrage, dass man erst recht ausgeschlossen wird. Es ist aus irgendeinem merkwürdigen Grund immer der Ausschluss, der mich heimsucht, als wäre man selbst das Problem und der Auslöser und als wäre man selbst nicht wirklich hilfreich, als wäre man das Übel, als wäre man umständlich, als wäre man in der Tat zu viel.
Womit man schliesslich nicht rechnet, nie rechnet, ist, dass man dort auf Ignoranz trifft, wo man mal eine warme Stelle Herz kannte oder zumindest vermutet hatte. Die Poesie der erlernten Erwartungen und die Dramatik der Angst vor allem und der Angst davor, ehrlich zu sagen ich nehme dich und deine Bedürfnisse ernst und ich halte mich an mein eigenes Wort.
Und dann ist da das Warten auf den Tag, der nie kommt.
Ich bin da und ich bin nicht da. Ich bin verschwunden, es gibt mich nicht mehr in der Form, wie andere Menschen mich kennen. Von Zeit zu Zeit kalibriere ich mich neu, lass etwas von mir hören, aber es gibt mich wirklich nicht mehr, es darf mich nicht mehr geben. Ich muss überleben, indem ich alles, was mir beim Überleben hilft, abstoße, ausschließe, auf die Straße werfe, ich werde so wie die fünf menschen, die ich in meiner unmittelbaren Reichweite habe und ich habe kein Problem damit, dass ich mich dadurch in eine komplett andere Richtung entwickle als damals. Damals. Damals.
Meine Mantren, mein inneres Yoga, Meditieren, vielleicht finde ich irgendwann in meinem Leben mal den Ausweg aus der Spirale im Kopf, das muss doch wahrlich eine Geschichte sein, die nicht nur auf der Straße erzählt werden kann, Freunden, die einen Ewigkeiten nicht gesehen haben, sondern das muss auf Papier stehen, es muss auf Papier stehen, wie ich lernte, mich zusammenzusetzen und wie ich jetzt wieder lerne, mich aufzulösen, dabei noch nicht einmal die richtigen Tasten zu treffen, denn ich konzentriere mich auf nichts anderes als die Worte, die aus meinen Fingerkuppen heraustropfen und ich hatte mir so sehr gewünscht, ich hätte dir davon erzählen können, aber ich rechnete wirklich mit allem ausser Ignoranz, ich hatte meine Rüstung angelegt, hatte meine schweren Stahlkappenschuhe angezogen für den Extraschutz und liess doch die wichtigste Stelle ungeschützt, den Kopf, kein Helm, nie mehr Helm, nie mehr etwas, das mit meinem Kopf herumarbeiten darf, nichts mehr, was ich nicht zulasse, niemand, dem ich explizit sagen muss: das tut mir weh. Don’t fuck with my insides, thank you very much.
Da ist noch nicht einmal Wut drin, egal wie sehr das Andere vermuten, egal, wie sehr ich mich auch dem Gedanken erwehren muss, dass ich das auslösende Element bin für alles Schlimme, was den Menschen passiert, die ich liebe oder geliebt habe. Will man das überhaupt überleben? Kann man es überleben?
In mir drin ist nichts weiches mehr, da ist nur eine kalte Fläche an dem Ort zurückgeblieben, der sich mal selbst versucht hat zu heilen, immer dieses Unkraut in mir drin, immer diese merkwürdigen Sachen und Vorstellungen und dieses Unkraut, das irgendwie immer überlebt, diese zwei verschiedenen Arten, aber eine Form davon überlebt die andere und ist stärker und kräftiger und deshalb kann das alles nicht so weitergehen. Denn ich frage mich sowieso, ab wann man das Leben als gescheitert betrachten kann.
Soll man eine Liste führen ob all der Dinge, die noch nicht sind oder nie waren? Soll man das, was man hört von Anderen, tatsächlich zu Herzen nehmen?
Man spricht meinen Namen nicht richtig aus, denn dieser Name hier war nie mein eigener, ich habe ihn nie bewohnt, weil ich es nie wollte. Davon sollte man erzählen, darum sollten sich die eigenen Geschichten ranken, denn wie viel besser kann man es eigentlich machen? Wahrscheinlich tatsächlich nur schlechter, die grosse Panik davor, so zu werden oder zu sein, wie Andere, gefangen in 0815, in Dingen, die man nicht will und nicht kann, weil sie einen kaputt machen. Nicht, weil man denkt, man hat sich auf eine gewisse Art zu verhalten sondern weil man denkt, man kann kein Leben so leben, wie man es gerne wollte, weil sich niemand findet, der auch nur im Ansatz dieses Leben teilen mag. Oder so ähnlich. Aber vielleicht dann, irgendwann, wieder die Unterstellung: du hast keinen Grund zur Sorge, keinen Grund zum Zweifeln. Du bist ja noch so jung, du weißt nicht, wie das mit dem Leben geht. I beg to differ. Wieso sonst verbrenne ich mir mit Absicht in heißem Wasser die Hände?